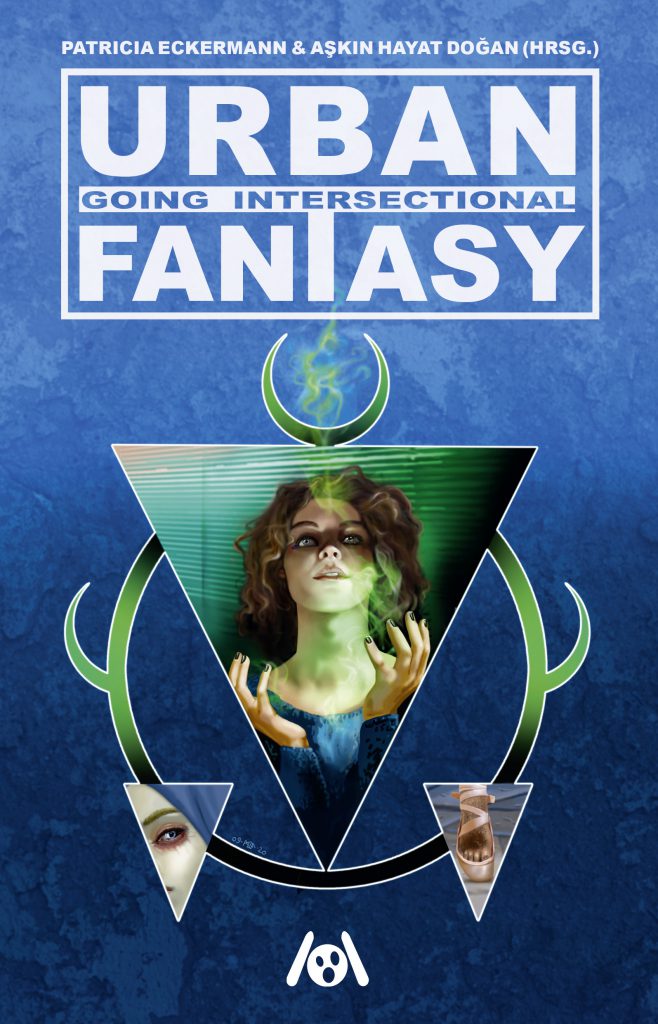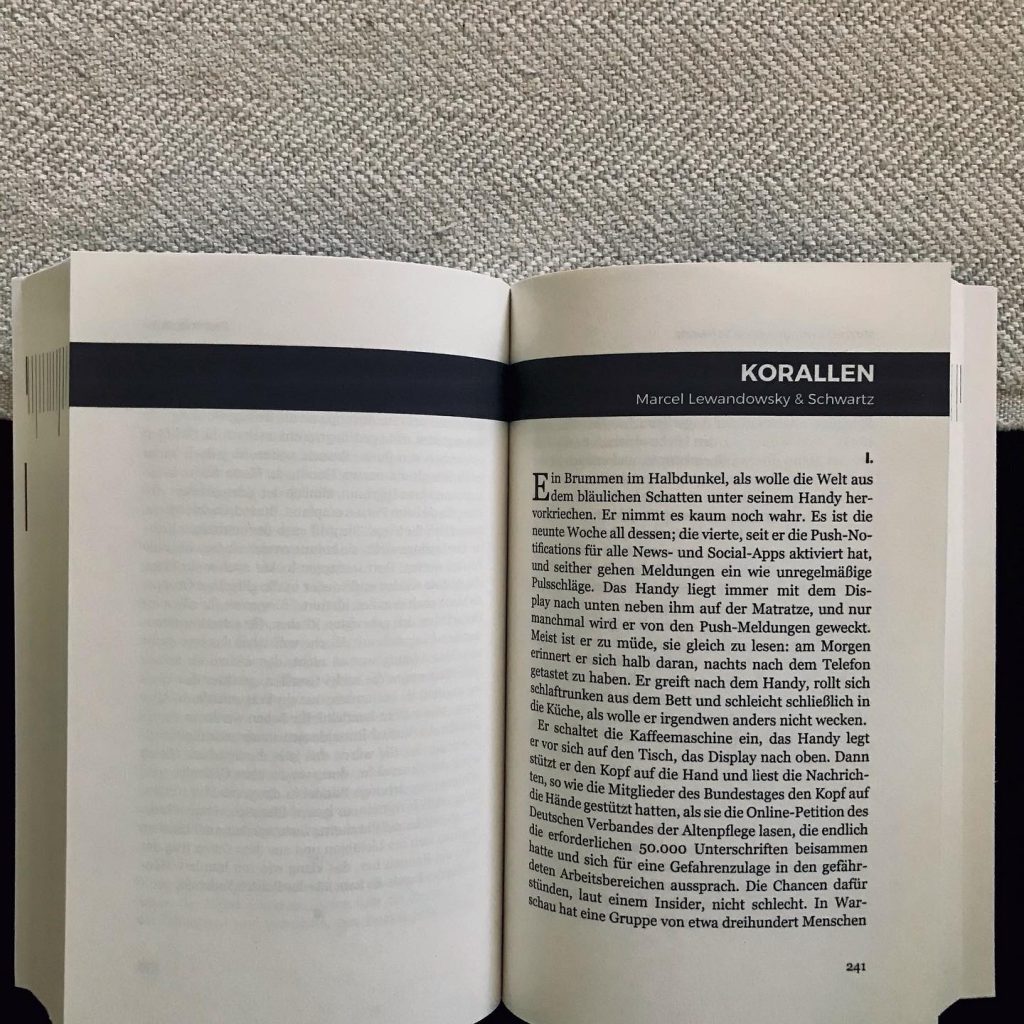Wer schreibt, der äußert sich irgendwann auch über das Schreiben selbst, ganz gleich, ob jemand danach fragt oder nicht. Im Grunde ist es wie mit dem schalen Witz, woran man einen Veganer erkennt: gar nicht, er sagt es einem von allein. Ich produziere Texte, also mache ich keine Ausnahme und will überlegen, was es auf sich hat mit dem Schreiben. Nur kurz und ich vermute, auch nicht zum letzten Mal.
Ich habe den Eindruck, dass Menschen, die sich zu ihrem eigenen Schreiben äußern, wie Whiskytrinker auf Parties sind. Es zu tun, ist die eine Sache, aber vor allem geht es darum, dabei gesehen zu werden, während man es tut, und dabei auch noch möglichst interessant auszusehen. (Davon kann ich mich selbst übrigens nicht freisprechen.) Dem Schreiben haftet eine ganz eigene Romantik an; weniger exaltiert als anderen Künsten, still, einsam, gebrochen: wer schreibt, verarbeitet etwas, das hinreichend dunkel ist, um reizvoll zu sein, aber nicht so düster, dass es abstößt.
Der Roman, den ich schreibe, ist eine Verarbeitung; meine Gedichte sind es ohnehin, und andere Texte, die ich plane oder schon geschrieben habe, sind es ebenfalls. Nur ganz selten schreibe ich über etwas, mit dem ich nicht versuche, innere Zustände zu verbalisieren, und ich stelle gerade fest, dass die Kurzgeschichte Korallen, die im Herbst erscheint, solch ein Text ist, was auch daran liegt, dass ich sie in einer Gemeinschaftsarbeit mit Schwartz verfasst habe. Nur: ein Schreiben, das nur Ausdruck innerer Zustände ist, in dem wir nur unser Innerstes präsentieren wollen, ist vielleicht eine gute Selbsttherapie, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich damit nicht literarisch arbeiten lässt.
Zu meiner Schulzeit hatte ich das große Glück, durch einen wunderbaren Lehrer, Herrn Grau, gefördert zu werden. Er betreute eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die sich an eigenen Texten versuchten. Wir saßen abends, lange nach Unterrichtsschluss, in der Schulbibliothek beisammen. Jede Woche wurde ein anderer Text diskutiert, zuerst gelesen und dann respektvoll und mit der gebotenen Klarheit kritisiert. Nirgends habe ich über das Schreiben so viel gelernt wie dort.
Was ich von dort mitgenommen habe, will ich an einem Beispiel illustrieren. Zuweilen kam es vor, dass jemand einen sehr persönlichen Text vorstellte, soll heißen: einen Text, der unmittelbaren Bezug zum Leben der Person hatte. Kam es dann zur kritischen Reflexion, die, wie gesagt, immer wohlwollend war, dann konnte es sein, dass der Mensch, der ihn geschrieben hatte, emotional reagierte, und es wurde klar, dass der Text noch nicht reif dafür war, überarbeitet zu werden. Es handelte sich also im Grunde genommen um einen Tagebucheintrag in Versform. Niemand würde darauf kommen, einen Tagebucheintrag zu redigieren. Tagebücher sind unmittelbares textliches Verarbeiten dessen, was uns bewegt; ihre Qualität ist ihre Authentizität.
Diese Authentizität ist aber nicht, so scheint mir, was Literatur ausmacht. Deren Qualität ist eng verbunden mit Gütekriterien, die kollidieren können, vielleicht sogar unvereinbar sind mit dem Anspruch, dass ein Text unmittelbarer Ausfluss der eigenen Gefühlszustände sein soll, also möglichst „echt“. Bestimmte Kriterien, seien es Spannungsbögen in der Prosa oder Rhythmik und Versmaße in der Lyrik, bedingen eine Verfremdung des Unmittelbaren und überführen es ins Künstliche.
Eines der sehr persönlichen Gedichte, die damals vorgetragen wurden, war mein Text „Jugend“. Das war 1999, und ich hatte darin einige für Pubertierende typische Probleme verarbeitet. Der Text war relativ lang. Leider habe ich die Urfassung nicht mehr. Aber als die Diskussion in der Schreibwerkstatt – so hieß unsere wöchentliche Zusammenkunft – abgeschlossen war, lautete er wie folgt:
Jugend
Schwarzer Raum.
Liebste,
da ist kein Licht.
In dieser Variante handelt sich eben nicht mehr um eine unmittelbare, sondern eine ästhetisierte, das heißt, einer ihn potentiell Lesenden zugänglich gemachten Fassung. Was ich sonst noch an Sorgen hatte, konnte ich einem Tagebuch anvertrauen; im Gedicht fehlten sie, aber dafür war ein Kleinod entstanden, das ich bis heute mag.
Literarisches Schreiben ist die Entscheidung, jemand anderem eine fiktive Idee zu überantworten. Mit dieser Entscheidung geht der Versuch der Empathie einher. Selbst das wahnwitzigste Textexperiment muss nachvollziehbar sein, und ist es das nicht, hat auch die Entfremdung von Leser eine innere Logik und Systematik. Wer Tagebuch schreibt, will von sich selbst verstanden werden; wer literarisch schreibt, will, dass andere ihn verstehen. (Es hat übrigens, trotz der Episode in der Schreibwerkstatt, Jahre gedauert, bis ich das verinnerlicht hatte.) Unromantisch daran ist, dass das literarische Schreiben, zumindest für mich, ein Arbeitsprozess ist, vergleichbar mit meinem Wissenschaftsberuf. Textproduktion, darauf ausgerichtet, dass der Sinn des Gesagten von unbekannten Dritten verstanden wird. Romantisch ist der Gedanke, dass am Ende dieses Prozesses das Wunder steht, dass eine Aneinanderreihung von Zeichen in der Vorstellung eines Anderen zu einer Skizze wird, einem Bild oder einer Geschichte.